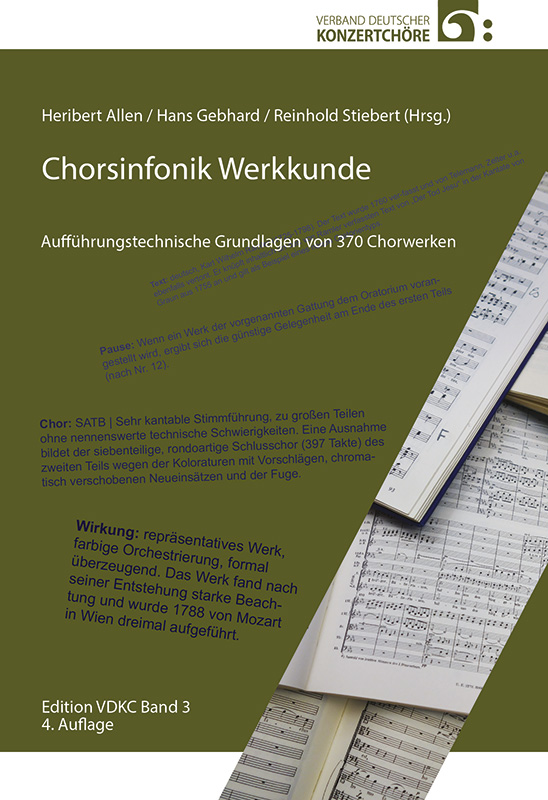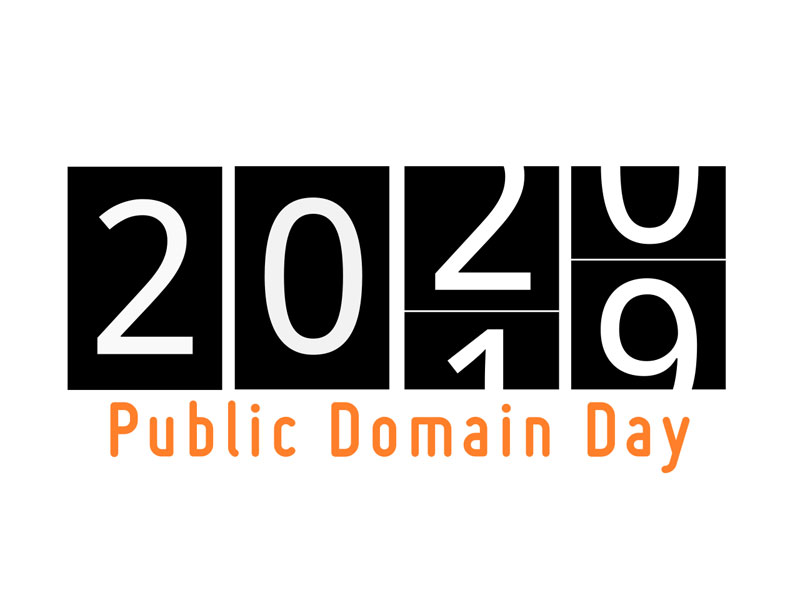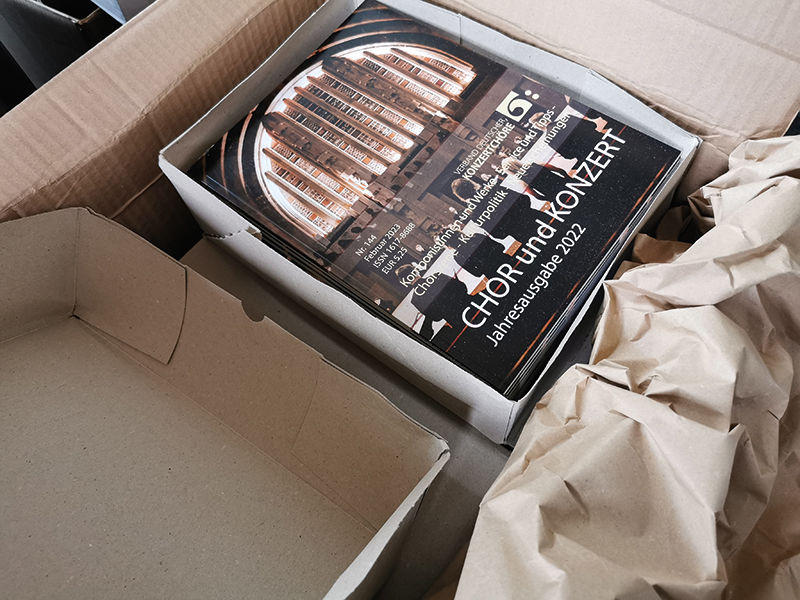Auf Antrag des VDKC wurde im Rahmen der entsprechenden UNESCO-Konvention die „Chormusik in deutschen Amateurchören" in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
Mitglieder Login
Der VDKC ist Mitglied im

Neuer Chor im VDKC
Wir begrüßen herzlich im Verband:
Norddeutscher Kammerchor
Dirigentin: Maria Jürgensen
25 Chormitglieder
VDKC-Landesverband Nordwest
VDKC Shop
BLACK FOLDER
Die ultimative Chormappe aus Kanada
Geschenk für Ehrungen:
BRONZEN VON E.G. Weinert
VDKC SCHRIFTENREIHE
Notenleihbibliothek
Orchestermateriale
Chorpartituren
Klavierauszüge
Partituren
Chorkarte des VDKC
| Fotos und Videos rechtssicher bei der Öffentlichkeitsarbeit verwenden |
 |
 |
Was ist bei der Nutzung in Bezug auf Rechte, Fristen und Lizenzen zu beachten?
Was ist ein Werk? Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) regelt die Nutzung von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst, also beispielsweise von Romanen und Gemälden ebenso wie von Fotos, Filmen, Kompositionen und technischen Zeichnungen. Der Urheberrechtsschutz entsteht automatisch mit der Schaffung eines Werkes, eine bloße Idee ist noch nicht geschützt. Ein Werk im urheberrechtlichen Sinne ist eine persönliche geistige Schöpfung, die eine eigene schöpferische Ausdruckskraft und einen bestimmten Grad an Kreativität (sog. „Schöpfungshöhe“) aufweist sowie von einem Menschen geschaffen wurde. Körperschaften können also keine Urheber sein. Urheber- und Persönlichkeitsrechte Bei der Nutzung von Werken werden verschiedene Urheber- und Persönlichkeitsrechte berührt, die zu beachten sind: Vermögensrechtliche Interessen Persönlichkeitsrechtliche Interessen Leistungsschutzrechtliche Ansprüche Beispiel: Bei der Veröffentlichung eines Zeitungsausschnittes oder einer Musikaufnahme im Internet muss neben dem Urheber (Journalist, Musiker) auch der Zeitungsverlag oder die Plattenfirma mit der Veröffentlichung einverstanden sein.
Ist eine Person auf einem Bild abgebildet und zu erkennen, ist für die Nutzung des Bildes grundsätzlich das Einverständnis der abgebildeten Person erforderlich. Dieses sogenannte „Recht am eigenen Bild“ gehört zu den allgemeinen Persönlichkeitsrechten und es gilt zu Lebzeiten des Abgebildeten und noch zehn Jahre darüber hinaus. Von einer stillschweigenden Erlaubnis wird gesprochen, wenn beispielsweise eine Person einem TV-Journalist ein Interview gibt und dabei gefilmt wird. Hier kann grundsätzlich von einem stillschweigenden Einverständnis der gefilmten Person hinsichtlich der späteren Veröffentlichung in einem Fernsehbeitrag ausgegangen werden. Kein Einverständnis ist erforderlich, wenn die Person im Zusammenhang mit einem Ereignis der Zeitgeschichte abgebildet ist, wenn die Person nur in einer größeren Gruppe von Menschen zu sehen ist und nicht besonders herausgestellt wird. Zuschauer bei Konzerten oder Teilnehmer von Festumzügen dürfen also grundsätzlich auch ohne Erlaubnis auf einem veröffentlichten Bild zu sehen sein. Hierbei ist aber Voraussetzung, dass die Kamera auf die gesamten Zuschauerreihen beziehungsweise den ganzen Festumzug und nicht auf einzelne Personen gehalten wurde. Tipp: Mustervorlage Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen im Downloadbereich des VDKC Schutzfristen und freie Nutzung
Die Regelschutzfrist (§ 69 UrhG) beträgt in der Regel 70 Jahre nach dem Tod des letzten Miturhebers; bei anonymen Werken sind es 70 Jahre nach der Veröffentlichung. Ausnahmen sind z.B. Lichtbilder (50 Jahre) und Datenbanken (15 Jahre nach Herstellung), auch sind international unterschiedliche Fristen zu beachten (z.B. Mexiko 100 Jahre, Kanada und Japan 50 Jahre). Werke mit abgelaufenem Urheberrechtsschutz werden danach „gemeinfrei“ (Stichtag 1. Januar – „public domain day“). Dennoch sind einige Punkte zu beachten, wie das folgende Beispiel zeigt: „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist gemeinfrei. Das Stück darf beispielsweise für einen Videoclip als Titelmusik verwendet werden. Allerdings ist die Leistung derjenigen, die das Musikstück aufführen und die es aufzeichnen, ebenfalls geschützt. Eine Audioaufnahme von einem Mozart-Werk fällt damit unter das Leistungsschutzrecht. Hat jemand bereits auf Basis eines gemeinfreien Werks ein neues Werk erstellt, unterliegt dieses wieder dem Urheberrecht. Ein Techno-Song auf Basis von „Eine kleine Nachtmusik“ darf nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers des Musikstücks genutzt werden.
Wikisource oder Wikipedia Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch freie Nutzungen ohne die Zustimmung des Urhebers möglich: Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) Freie Benutzung (§ 24 UrhG) Zitatrecht (§ 51 UrhG) Urheber- und Persönlichkeitsrechte beim Live-Streaming Von der Möglichkeit, Geschehnisse live im Internet zu streamen, wird heute immer öfters Gebrauch gemacht. Im Unterschied zu Videos, die auf Plattformen YouTube oder Vimeo vor der Veröffentlichung in der Regel geschnitten oder bearbeitet werden können, gelangt das live gestreamte Video sofort ins Internet. Es ist also nicht möglich, Personen unkenntlich zu machen oder Szenen herauszuschneiden. Daher muss vorher das Einverständnis der Personen eingeholt werden. Außerdem sind auch Werke bei der Veröffentlichung in Videoaufnahmen vom Urheberrecht geschützt. Es ist also nicht erlaubt, Kunstwerke, Kinofilme oder Inhalte, die im Pay-TV gesendet werden, zu übertragen. Auch Hintergrundmusik ist sorgfältig auszuwählen. In der Regel müssen hier GEMA-Gebühren gezahlt werden. Wer regelmäßig für einen größeren Kreis an Zuschauer oder Hörer senden möchte, sollte vorab prüfen, ob eine Sendelizenz notwendig ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 500 Personen erreicht werden, es um journalistisch-redaktionelle Inhalte geht und wenn es feste Sendezeiten gibt. Bei größeren Sport- oder Kulturveranstaltungen werden die Aufnahme- und Verbreitungsrechte üblicherweise verkauft. In diesem Fall dürfen nur die Käufer Bilder und Videos davon veröffentlichen und verbreiten. Verwendung von Werken Wenn ein Verein ein Werk, beispielsweise aus dem Internet, verwenden möchte, muss er sich um die Einräumung der Nutzungsrechte kümmern (§ 31 UrhG). Dabei gibt es verschiedene Unterscheidungen und Geltungsbereiche wie z.B. exklusive und nicht-exklusive Lizenzen, übertragbare oder nicht übertragbare Lizenzen, auch gelten räumliche, zeitliche und territoriale Beschränkungen. Lizenzen, die z.B. öffentliche Filmvorführungen oder die Verwendung von Musik berühren, werden über das Unternehmen MPLC (Motion Picture Licensing Company) und die GEMA geregelt. Bei der Nutzung von Werken wie z.B. Bildern, Videos, Musik und Software, aber auch wissenschaftliche Arbeiten und andere Arten von Werken empfiehlt es sich, frei lizensierte Werke zu nutzen, die ein kostenlose Nutzung erlauben. Aber auch hier gilt, dass auch diese freien Lizenzen Bedingungen enthalten, die Rechteinhaber für die Verwendung ihrer Werke festgelegt haben. Denn „freie Nutzung“ bedeutet nicht automatisch „uneingeschränkt freie Nutzung“. Creative Commons (CC) Quellen: Creative Commons: https://de.creativecommons.net/start/ | Suchfunktion: https://search.creativecommons.org/ Erweiterte Google-Bildersuche, Filter „Nutzungsrechte“: https://www.google.com/advanced_image_search Wissensplattform Wikipedia, Wikimedia Commons: Bilder, Bedingungen für Weiterverwendung beachten Weitere Bilddatenbanken z.B.: Pixelio.de, Unsplash.com, Flickr Einbettung von Werken Es ist auch empfehlenswert, urheberrechtlich geschütztes Material auf der Internetseite einzubetten, anstatt es neu hochzuladen. Beim „Einbetten“ wird ein bereits veröffentlichtes Werk durch das Kopieren des Programmiercodes auf einer anderen Plattform zugänglich gemacht. So ist beispielsweise ein Video, das auf einer anderen Plattform angezeigt wird, dann auch auf der eigenen Website zu sehen. Das Video bleibt also beim Einbetten auf der Plattform, auf der es ursprünglich hochgeladen wurde. Zunächst sollte vor dem Einbetten von Fotos oder Videos erst geprüft werden, ob ein Werk tatsächlich rechtmäßig eingestellt wurde, das heißt durch den Urheber selbst oder mit der Einwilligung von Dritten. Ein Einbettungscode, den eine Plattform bereitstellt, ist keine Garantie für eine rechtmäßige Quelle. Im Zweifel sollte daher lieber auf eine Einbettung verzichtet werden. Beispiel: Abrufen des Einbettungscodes bei YouTube:
Möglichkeiten der Einbettung von Grafiken und Videos bieten auch Portale wie facebook, Instagram und Twitter.
Trotz sorgfältiger Prüfung passiert es manchmal, dass ein Werk nicht urheberrechtskonform verwendet wird. Der Urheber hat ein Recht auf Unterlassung, Auskunft, Schadenersatz (entgangener Gewinn oder Herausgabe des Gewinns) und die Vernichtung von Vervielfältigungsstücken. Voraussetzung dafür ist, dass der Rechteinhaber den Nutzer abmahnt, die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre (§ 102 UrhG). Eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre (§ 106 UrhG) ist möglich. Eine Abmahnung enthält in der Regel die folgenden Punkte: Beschreibung des Sachverhalts und der Rechtsansicht; Aufforderung zur Beseitigung der Rechtsverletzung (Was soll der Empfänger tun?); Unterlassungserklärung (Aufforderung zur Unterschrift, die dazu verpflichtet, die beschriebene Rechtsverletzung nicht zu wiederholen); Schadensersatz und Auskunftsanspruch (Was soll der Empfänger bezahlen und wie lange wurde das Werk verwendet?); Abmahnungskosten (Welche Kosten fallen für den Rechtsbeistand an?) sowie Androhung gerichtlicher Schritte. Erhält der Nutzer eine Abmahnung, gilt zunächst: Ruhe bewahren. Es wird empfohlen, nicht sofort zu unterschreiben und zu zahlen, aber auch keine Fristen verstreichen zu lassen. Die Echtheit der Abmahnung muss geprüft werden, besonders bei Abmahnungen per E-Mail. Anwaltskanzleien versenden Abmahnungen normalerweise per Brief. Bei Bedarf ist eine Beratung seitens der Verbraucherzentrale oder durch einen Anwalt einzuholen. Eine Unterlassungserklärung sollte nicht ohne juristische Beratung unterschrieben werden. Wird innerhalb der gesetzten Frist nur eine unzureichende oder gar keine Unterlassungserklärung abgegeben, kommt es in der Regel zu einem vereinfachten, besonders schnellen Gerichtsverfahren. Hier ist bereits mit erheblichen Kosten zu rechnen, bei schuldhaftem Verhalten können zudem Schadensersatzansprüche hinzukommen. Wer eine rechtmäßige Abmahnung erhält, muss also in jedem Fall reagieren. Quelle: Digitale Nachbarschaft Abbildungen:
|
Schlagzeilen
| CHOR und KONZERT 2022 ist erschienen |
Verbandszeitschrift des VDKC
Hier lässt sich noch einmal prima nachlesen, was im vergangenen Jahr alles an spannenden und wissenswerten Artikeln veröffentlicht wurde. CHOR und KONZERT ist ab sofort auch im VDKC-Shop zu erwerben: hier. VDKC |
Das Infoportal der Amateurmusik

Der schlaue Fuchs Amu (der Name steht für "Amateurmusik") gibt Antwort auf Fragen rund um die Amateurmusik. Das Infoportal bündelt zahlreiche Angebote zu Wissen, Praxis und Beratung:
Spenden an den VDKC
 Wir bitten um Ihre Unterstützung
Wir bitten um Ihre Unterstützung
Terminkalender für Chöre

- 10. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival Calella (01.05.2024)
- 8. HARMONIE FESTIVAL (09.05.2024)
- Chorworkshop mit Konzert: W. A. Mozart – Krönungsmesse (16.05.2024)
- 13. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival in Paris (29.05.2024)
- 8. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival (26.06.2024)
Aus den Chören
- Philharmonischer Chor Essen: Patrick Jaskolka erhält Titel „Chordirektor BMCO“
Konzerterfolg und Auszeichnung für den Chorleiter Mit großem Erfolg und stehenden Ovationen konnte der Philharmonische Chor Essen am 09.12.2023 in... - Aalener Kammerchor feiert 40-jähriges Jubiläum
Uraufführung von Edgar Manns „Missa Brevis Pentecostes“ In diesem Jahr feiert der Aalener Kammerchor sein 40-jähriges Bestehen. Daher widmet sich... - Erfolgreiches Jahr für die Hallenser Madrigalisten
Preisträgerchor feiert 60-jähriges Jubiläum Was für ein Jahr für den Kammerchor Hallenser Madrigalisten! Kurz nach ihrem 60. Geburtstag im Mai 2023...
Aktuelle Veranstaltungen
- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Jauchze, Seele!
- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Musik kennt keine Grenzen
- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Schmerz und Entzücken der Liebe
- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Vivat Carl Philipp: Israeliten in der Wüste CPE Bach
- Alle anzeigen
- Veranstaltungsarchiv anzeigen