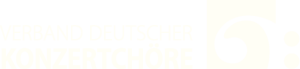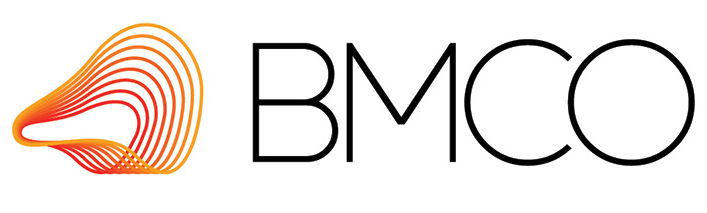Stabat Mater
Autor: Karin Lingnau, Wortanzahl: 520
Lizenzgebühr für Chöre, die nicht Mitglied im VDKC sind: 12,38 € inkl. MwSt.
1. Die Nutzung des Textes für Programmhefte ist für Mitgliedschöre des VDKC, die selbst an der Aufführung des Werkes beteiligt sind, unter Angabe der Quelle (Autor und Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verbandes Deutscher KonzertChöre.), kostenfrei.
2. Chöre, die kein VDKC-Mitglied sind, können den Text gegen Zahlung einer Lizenzgebühr und unter Angabe der Quelle (Autor und Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verbandes Deutscher KonzertChöre.), verwenden. Die Gebühr ergibt sich jeweils aus der Anzahl der Wörter und wird anteilig vom VDKC an den Autoren weitergeleitet. Die Zahlung leisten Sie bitte vor Verwendung des Textes auf folgendes Konto: VDKC, IBAN: DE60 8205 4052 0305 0198 48, BIC: HELADEF1NOR bei der Kreissparkasse Nordhausen.
Kopieren ab hier >>>
Das mittelalterliche Gedicht Stabat mater dolorosa ... (Es stand die Mutter schmerzerfüllt ...) beschreibt den Schmerz der Gottesmutter um ihren Sohn. In der katholischen Kirche spielt Maria eine wichtige Rolle in der Leidensgeschichte Christus, und wird auch als schmerzensreiche Mutter Mater dolorosa bezeichnet und verehrt. Diese Marienverehrung entwickelte sich u. a. aus der Betrachtung der Person Maria als weiblicher und menschlicher Part innerhalb eines ansonsten hauptsächlich männlich orientierten Gotteskonzepts. Diese Präsenz zeigt sich maßgeblich in zwei religiösen Texten: Magnificat und Stabat mater.
Das Magnificat als biblischer Text beschreibt den Lobgesang Mariä zur Geburt Jesus Christus. Das Stabat mater dagegen drückt gerade in seinen ersten Strophen ein ergreifendes Mitgefühl für die Mutter Christi aus, die am Kreuz ihres Sohnes steht und wacht. Referenzen sind die sieben Schmerzen Mariä, im zweiten Vers zum Beispiel der Bezug zur Prophezeiung Simeons: „Durch die Seele voller Trauer, seufzend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging (Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, pertransivit gladius)". Hierzu Lukas 2, 35: „und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf dass vieler Herzen Gedanken offenbar werden."
Die Darstellung des Herzens Mariäs mit sieben Schwertern durchbohrt, basiert auf dieser Textstelle und versinnbildlicht die sieben Schmerzen, die die Lebensgeschichte der Mutter Gottes bestimmt haben (Weissagung Simeons; Flucht nach Ägypten vor dem Kindermörder Herodes; Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel; Begegnung zwischen Jesus und seiner Mutter am Kreuzweg; Kreuzigung und Sterben Christi; Kreuzabnahme und Übergabe des Leichnams an Maria; Grablegung Jesu).
Der Text des Stabat mater bezieht sich auf den Moment des Mitleidens mit der Figur Maria mit ihrem Sohn und die Bitte, das Gebet, ihr Leid mitzuerleben und mitzutragen, um Seele und Geist zu befreien und am Ende des Himmels Seligkeit zu erben (Quando corpus morietur fac ut animae donetur paradisi gloria).
In der Kunst wird die leidende Madonna in drei bekannten Posen gezeigt: trauernd an der rechten Seite des Kreuzes ihres Sohnes stehend, als Mater dolorosa und als Pietà. Das Mitleiden und gerade die Pietà als Bild sind die Grundlagen der Identifikationsfigur Maria.
Stabat mater bezeichnet hier Maria, stehend am Kreuz, als Akteur und Zuschauer gleichermaßen, als Symbol des Glaubens im Anblick des Gekreuzigten. Maria in idealisierter Form persönlich (als Mutter) und als personifizierter Glauben.
Ein anderer Schwerpunkt ihrer Schmerzen ist die Entfremdung von ihrem Sohn (z. B. Verlust des zwölfjährigen Jesu im Tempel), die ihre trotz all dieser Widrigkeiten und Trauer beständige Zugehörigkeit und ihren Glauben nicht erschüttern. Maria wird somit zum unmittelbaren Symbol einer Menschlichkeit, die den persönlichen und unerschütterlichen Bezug zur Göttlichkeit eingeht. Leiden und Tod Jesu werden menschlich, Maria dient als Vorbild und Stütze in der Heilsgeschichte im katholischen Glauben und als Grundmodell menschlicher Leidens- und Lebenserfahrung.
Die Sieben Schmerzen finden ihr Pendant in den Sieben Freuden Mariens: Mariä Verkündigung, Mariä Heimsuchung, Geburt Jesu, Anbetung der Könige, Wiederfinden des zwölfjährigen Jesu im Tempel, Auferstehung Jesu, Aufnahme Mariens in den Himmel mit Krönung.
Karin Lingnau
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verbandes Deutscher KonzertChöre.