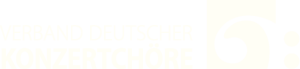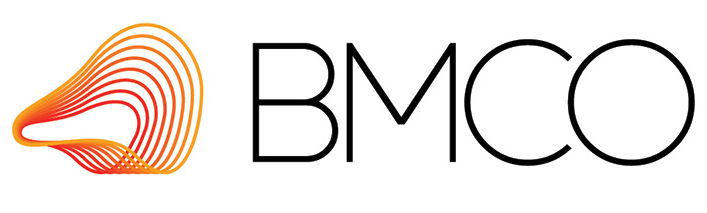CHORizonte: Reflektionen zur Chormusik des 21. Jahrhunderts
Ekkehard Klemm im Gespräch mit Charlotte Seither (Komponistin, Mitglied im GEMA-Aufsichtsrat, im Vorstand des Deutschen Komponistenverbands und im Präsidium des Deutschen Musikrats).
E.K.: „Wir müssen die Dinge ausreichend zerstört haben, um sie zu begreifen. Wir müssen sie aber auch sichtbar leimen und ihre Narben in Rahmen legen, damit sie Ganzes und Teil und beides in einem sind“ – dieser Text findet sich unter dem Stichwort „Ästhetik“ auf Ihrer Website. Was zerstören Sie, wenn Sie ein Chorwerk schreiben – und wie leimen Sie das Begriffene wieder zusammen?
C.S.: Chormusik ist etwas Wunderbares. Sie ist oftmals aber auch stark „besetzt“: In ihrer Geschichte ist sie nicht selten an eine Funktion gebunden, an den Gebrauch im Gottesdienst zum Beispiel. Daraus ergeben sich Gewohnheiten, von denen wir glauben, sie müssten so sein. Als Komponistin interessiert mich, Chormusik zu allererst wie Kammermusik anzuschauen. Ein Werk wie „paintings“ oder „ahnst du“ könnte dem Titel nach auch ein Streichquartett sein. Für mich ist Chormusik kein Gefäß, das ich fülle. Sie ist eine offene Fläche, auf der ich die Art, wie ich denke, erst noch erfinde.
Anders als viele zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten haben Sie viel Chormusik geschrieben, darunter auch Werke für Amateurchöre. Wie singbar muss Chormusik aus Ihrer Sicht sein? Wie lösen Sie den Spagat zwischen Anspruch und Realisierungsmöglichkeiten?
Wir haben im Land eine hochqualifizierte Chorszene, gerade auch unter den jungen Amateurchören in den Universitätsstädten, und das Niveau der Chöre steigt ständig weiter. Ich arbeite sehr gerne mit diesen semiprofessionellen Ensembles, sie sind hochmotiviert und leistungsstark. Im Kern stecke ich beim Komponieren dafür nur wenig zurück: Es interessiert mich ja gerade nicht, möglichst schwierige Tonsprünge oder Rhythmen aufzuschreiben. Mir geht es vielmehr um die unendlich vielschichtige Arbeit am Klang. Mit den BBC Singers kann ich sicher hochdifferenziert an einer Vokalumfärbung arbeiten. Mit einem jungen Chor geht das im Kern aber auch, wenn die Sänger*innen spüren, worauf es ankommt und wie ein Stück klingen soll.
Sie sind eine Komponistin, die sich dezidiert gesellschaftlich engagiert und politisch einmischt, bspw. im Aufsichtsrat der GEMA oder im Präsidium des Deutschen Musikrats. Wieviel schöpferische Energie rauben diese Tätigkeiten der Komponistin und was fließt dennoch an Inspirierendem in den Prozess des Komponierens?
Ich finde die reale Welt draußen sehr spannend. Sie bildet einen willkommenen Gegenpol zu meiner starken Innenwelt und lotet mich dabei immer wieder neu aus. Ich beobachte gerne, greife ein, bringe Ideen ins Spiel, wenn ich es für richtig halte. Insofern ist dies alles eine Frage der Balance: Zu viel Innenwelt ist nicht wirklich erquicklich, zu viel Außenwelt kann ebenfalls erschöpfen. Im richtigen Verhältnis der Kräfte – und auch der Ruhe dazwischen – macht beides stark.
Gegenwärtig tobt ein Streit über die in der GEMA geplante Strukturreform, die Sie als Mitglied im Aufsichtsrat und Vertreterin der Sparte „E-Musik“ selbst deutlich kritisiert haben. Die Chöre kämpfen ihrerseits um einen GEMA-Tarif für die Amateurmusik, damit die Aufführung zeitgenössischer Musik nicht behindert wird. Welche Chancen sehen Sie, die Interessen zusammenzubringen und wie sehen Sie Ihre eigene Position im Konflikt zwischen U- und E-Musik – ist die Trennung noch sinnvoll und aufrechtzuerhalten?
Ich unterscheide zwei Dinge: Nach wie vor macht es für mich einen großen Unterschied, ob Musik in einem kulturellen oder kommerziellen Kontext entsteht. Die Entstehungs- und Aufführungsbedingungen von Musik unterscheiden sich mitunter also deutlich. Die schwedische Verwertungsgesellschaft STIM unterscheidet dabei nicht mehr nach „ernst“ oder „unterhaltend“, sie unterscheidet, ob eine Musik kommerziell oder als „market disadvantaged music area“ zu verstehen ist. Ein Arvo Pärt würde dort keine Förderung mehr erhalten, auch wenn seine Musik klar „ernst“ ist. Die Begriffe E und U helfen uns letztlich nicht mehr weiter, die Unterscheidung von „kulturell“ und „kommerziell“ grundiert aber schon. Bei aller Richtungsdiskussion muss also klar sein: Die Gesetze des Marktes können und dürfen niemals zum Maßstab erhoben werden, an dem wir Kultur bemessen. Kultur ist der Grundstein von geistiger Freiheit. Und Freiheit ist nie von sich aus da – sie muss jeden Tag aufs Neue erworben und verteidigt werden.
VDKC
30.04.2025