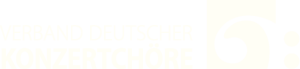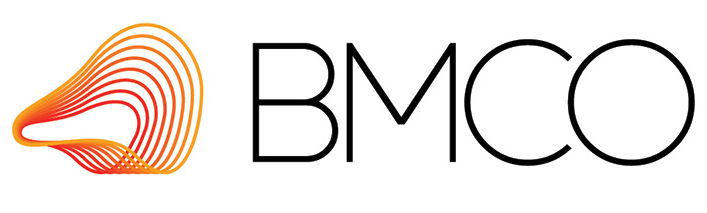CHORizonte: Reflektionen zur Chormusik des 21. Jahrhunderts
Ekkehard Klemm im Gespräch mit Prof. Marcus Bosch (Dirigent und Vorsitzender der GMD-Konferenz)
EK: Welche Rolle spielen die Amateurchöre in der gegenwärtigen Musikszene deutscher Konzert- und Opernorchester?
MB: Ich denke eine sehr große! Meine Erfahrung ist, dass bei entsprechender Qualität, jeder GMD versuchen wird, die Chorlandschaft in das Programm des Orchesters miteinzubeziehen.
Philharmonische Chöre, Singakademien, Extrachöre, Kinderchöre sind nicht nur Multiplikatoren des Musiklebens einer Stadt, sondern auch Garanten ihrer Lebendigkeit. Die großen Institutionen und Spitzenorchester setzen dennoch eher auf Kooperationen mit Rundfunkchören. Liegt das an mangelnder Leistungsfähigkeit von Amateurensembles oder sollten diese offensiver auf die GMDn zugehen und Konzerte einfordern?
Ich maße mir nicht an für alle Städte und Kolleg*innen zu sprechen. Aber in der Tat ist der Leistungsunterschied zwischen Amateurchor und dem jeweiligen Orchester oft gravierend in Fragen von Intonation, Flexibilität, Stilistik, Arbeitstempo… Aber es gibt unglaublich viele Spitzenensemble im Amateurbereich. Trotzdem – miteinander reden hilft immer. Was sich ja auch immer wieder in gewinnbringenden Kooperationen mit den jeweiligen Theaterchören äußert, die leider nicht immer offen genug sind.
In welchem Umfang gehören Konzerte mit und für Chöre und Kantoreien zu den tariflichen Aufgaben der Kulturorchester? Inwieweit können sie dazu verpflichtet werden?
Im Moment sehe ich keine vertraglich begründeten Zusammenhänge – außer sie sind im GMD Vertrag oder städtischen Kooperationsvereinbarungen hinterlegt.
Stichwort Repertoire: Wieviel Chormusik prägt die deutschen Sinfoniekonzerte? Wie viele Entdeckungen sind auf den Spielplänen zu finden und wie oft die altbekannten Highlights Beethoven 9 bis Carmina Burana? Sind das die einzigen Aufgaben, bei denen die Amateure mitmachen dürfen?
Zum letzten Punkt: ganz klar nein. Aber leider gehen die Zeiterscheinungen auch nicht an den Chören vorüber, und nicht überall war der Wille zur Veränderung durch Leitung und oder Vorstand gegeben. Dass der Reichtum der sinfonischen Chormusik auf den Spielplänen in der Regel nicht abgebildet ist, ist leider Fakt. Aber man muss auch an vielen Stellen selbstkritisch konstatieren, dass man nicht alle Beteiligten zu einer neugierigen Haltung verführt hat.

Wäre es ein sinnvolles Modell, die Verantwortung für die Amateurmusikszene einer Stadt zu den Grundaufgaben eines GMDs zu machen? Die/der GMD als ständiger Ansprechpartner und Kommunikator für Amateurorchester, -chöre und vor allem Musikschulen? Wir das bereits gelebt? Oder steht die internationale Gasttätigkeit dem entgegen?
Genau das stand in meinem Vertrag in Aachen, der auch in weiten Teilen zum Mustervertrag für GMDs geworden ist. Wir sehen in der GMD-Konferenz den bzw. die GMD als Pulsgeber für das ganze Musikleben einer Stadt. Das hat mit einer Gasttiertätigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern immer mit den handelnden Personen und ihren Interessenslagen auf allen Seiten.
Wie erlebt der GMD aus Rostock, der Professor der Münchner Musikhochschule, Intendant eines erfolgreichen Opernfestivals und internationale Gastdirigent selbst die Zusammenarbeit mit Amateurchören? Inwieweit profitiert seine Arbeit davon und wäre ohne diese nicht denkbar?
Mein Habitat ist die Chormusik. Ich habe mit 14 den Kirchenchor meiner Eltern übernommen, in einem sehr guten Kammerchor in der Schulzeit und dann u.a. bei Frieder Bernies im Stuttgarter Kammerchor gesungen und auch bei ihm studiert (und viel mit ihm diskutiert…). Bis heute verstehe ich die Trennung in der Ausbildung zwischen Chor- und Orchesterdirigieren nicht. Ein weites Feld…
Mit 18 habe ich dann meine vocapella gegründet – zunächst als Chor, später auch ein Orchester. Der Chor aus meist ambitionierten Amateur*innen besteht bis heute und gestaltet immer wieder Aufführungen auch im Rahmen der Festspiele. Manche kleinen “Löcher” stopfen wir mit dem VokalWerk der Opernfestspiele, das ich in meiner Nürnberger Zeit speziell für Bach-Aufführungen und neue Musik gegründet habe. Im Studium habe ich den Beethovenchor Ludwigshafen für 10 Jahre übernommen – mit großer Weitung des Repertoires und auch einer szenischen Aufführung des Paulus gemeinsam meistens mit der Staatsphilharmonie Ludwigshafen. In Aachen war der städtische Chor, der unter Karajan als bester Chor ganz Europa bereist hat, ein Nukleus der Herausforderungen der städtischen Singvereine. Da konnte ich dann die Anregung zu einer internationalen Chorbiennale geben, die inzwischen tausende Menschen in der Festivalwoche bewegt und alle Chöre der Region miteinbezieht. Das ist sicher beispielhaft und hätte viele Nachahmungen verdient!
In Rostock habe ich die Singakademie, die in die Konkurrenz einer sehr guten Kantorei gerutscht und zwischen der typischen 9. Beethoven und als Extra-Chor auf Profilsuche ist. Der Versuch – auf vielfachen Wunsch – ein eigenes Format zu schaffen, wurde dann konterkariert mit privaten Terminkonflikten. Eine ganze typische Problemstellung.
Zusammenfassend – funktionierende Amateurchöre sind für das Musikleben einer Stadt ein großer Booster, wenn es ein Miteinander und ein positive Konkurrenz gibt. Ein ständiger Austausch des GMDs mit allen ChorleiterInnen kann viel verstärken und zusammenführen. Mein extremes Positivbeispiel ist und bleibt die Situation, die wir in Aachen herstellen konnten.
VDKC
26.09.2025