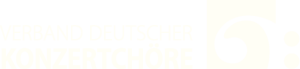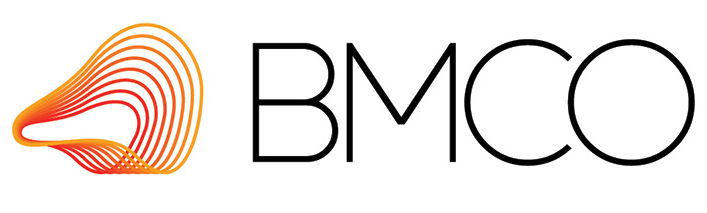CHORizonte: Reflektionen zur Chormusik des 21. Jahrhunderts
Ekkehard Klemm im Gespräch mit Prof. Dr. Ulrike Liedtke (Präsidentin des Landtages in Brandenburg, Vizepräsidentin des Deutschen Musikrates, Musikwissenschaftlerin und Autorin, Gründerin der Bundesmusikakademie Rheinsberg)
EK: Hand aufs Herz, liebe Frau Professor Liedtke: Eine Musikwissenschaftlerin an der Spitze eines Landtages in Deutschland, das ist doch eine sehr außergewöhnliche Berufskarriere!? Was bringt einen von der musikalischen Forschung und der Leitung verschiedener Musikinstitutionen derart ins Zentrum der Politik?
UL: Noch immer betrachte ich die friedliche Revolution 1989 als Chance, Kunst und Kultur frei zu gestalten. Ich arbeitete noch an der Akademie der Künste in Berlin und engagierte mich zugleich in Hohenschönhausen in der SDP, der Ost-Sozialdemokratie. Wir trafen uns im Wohnzimmer meiner Neubauwohnung bei Tee und Plätzchen mit vielen guten Ideen für Kultur im vereinten Berlin. Ich bin immer noch froh, dass auf diese Weise Kürzungen im Berliner Kulturleben verhindert werden konnten. Wieso zwei Singakademien, wieso so viele Orchester – ganz einfach, weil ja die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger in Berlin mit der Einheit nicht kleiner geworden war. Dann kandidierte ich zur ersten freien Kommunalwahl und hatte die meisten Stimmen, also musste ich ran! Als ich dann später als Gründungsdirektorin die Musikakademie Rheinsberg leitete, packte mich oft die Wut über fachlich falsche Kulturentscheidungen oder intransparente Förderungen. Also musste ich selbst etwas tun. So kam ich in den Landtag Brandenburg. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass Politik auch Menschen braucht, die mit den Ohren denken.
In Ihrer Jugendzeit wurden Sie stark durch das Elternhaus musikalisch geprägt, später sangen Sie während des Studiums im Gewandhauschor und im Extrachor der Leipziger Oper – gehören die Amateurchöre zu Ihrem Lebenselixier und zu den Sie prägenden Einflüssen?
Ich bin im Theater aufgewachsen. Die Opernchöre rauf und runter waren mein Lebenselixier. Mit größter Selbstverständlichkeit dirigierte mein Vater in allen Städten, in denen wir waren (ich war in sechs Schulen), einen Männerchor, ein Ärzteorchester oder musizierende Lehrer. Es gab irgendwie gar keinen Unterschied zwischen Proben und Konzerten mit Profis oder Amateuren, sie mussten einfach gut sein. Als ich mit 17 den Unterricht in der sozialistischen Produktion im VEB Schreibmaschinenwerk „Optima“ in Erfurt absolvierte, gründete ich meinen ersten Chor für ein Betriebsfest – einen Frauenchor. Ich war wahnsinnig stolz auf „meine“ Frauen und staunte immer wieder darüber, dass sie mir folgten, obwohl ich mich doch selbst als Anfängerin sah.
Chorsingen hat immer mit Magiern zu tun – ich sang u.a. bei Gerd Frischmuth in Erfurt, Andreas Pieske und Georg Christoph Biller in Leipzig, bei der Eröffnung des Gewandhauses unter Kurt Masur und in der Leipziger Oper dirigierte André Rieu (der Vater des Geigers) den Wach-auf-Chor in den „Meistersingern“ mit Theo Adam und Peter Schreier auf der Bühne. Das waren Sternstunden und ich empfand es auch so. Heute bin ich das einzige weibliche Mitglied im Arbeitergesangsverein Rheinsberg, ein Männerchor.
Regionalgeschichtlich interessiert mich der Kantor, Chorleiter und Komponist Ferdinand Möhring. In Neuruppin gibt es eine Möhring-Straße und ein Möhring-Denkmal, auch einen Möhring-Chor. Aber niemand wusste mehr, was dieser Möhring komponiert hat. Also gründete ich mit Freunden eine Möhring-Gesellschaft und im August gaben die Ruppiner Kantorei, der A-cappella-Chor Neuruppin, Chorisma Neuruppin und der Möhring-Chor ein ganz großartiges und bestens besuchtes Konzert ausschließlich mit Kompositionen von Möhring in der Klosterkirche Neuruppin. Der Mendelssohn-Schüler und Mitbegründer des Deutschen Sängerbundes in Nürnberg wird wieder gesungen. Ohne Amateurchöre geht es gar nicht!
Unter dem Thema „Demokratie und Musik“ werden Sie an der Universität Potsdam demnächst ein Seminar gestalten. Was werden die zentralen Schwerpunkte und Erkenntnisse sein, die Sie den Studierenden auf den Weg mitgeben?
Das Seminar hat einen irritierenden Titel: „Ist eine Haydn-Sinfonie demokratisch?“ Natürlich ist die Kunst frei. Aber was passiert in solch einer Sinfonie? Viele verschiedene Stimmen tauschen sich aus, manche auf Holz, manche reden Blech oder blasen heiße Luft, musikalische Prinzipien sind übertragbar auf gesellschaftliches Miteinander. Die Themen eines Sonatenhauptsatzes oder das Zusammenfinden im Rondo, Imitation, wenn es ein guter Gedanke ist, Variationen eines mehrfach anwendbaren Themas – alles das müssen wir miteinander neu lernen, um besser zuzuhören. Hinzukommt, dass man wissen muss, wann man einsetzt und ob man sich laut oder leise, schnell oder langsam äußert. Das beschreibe ich gerade noch ganz ohne die Botschaft eines Textes, der zur Musik hinzukommen kann. Musik und Demokratie haben also viele Verfahren gemeinsam. Als Musiker und Musikerinnen können wir damit gut umgehen, weil es unsere tägliche Beschäftigung mit Musik und sozusagen auch mit Demokratie ist.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Amateurmusik in Deutschland, wie kann sie ausreichend und besser gefördert werden? Sind die aktuell 16,3 Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit Musik machen, tatsächlich ein Vorbild demokratischen Miteinanders oder eher jene Träumer*innen, die gern zurückschauen und eine alte, westeuropäisch konnotierte Tradition aufrecht zu erhalten suchen? Können wir mit dieser Kultur in der sich rasend verändernden Welt noch Schritt halten?
Die Träumerei ist ein Vorurteil. Ich kenne keinen Musiker, keine Sängerin, die während der Ausführung einer musikalischen Arbeit träumen. Musik verlangt so viel Konzentration, Genauigkeit und Sensibilität, dass niemand währenddessen träumen kann. Eher verbindet sich Kreativität mit gedanklichen Spaziergängen und Neuem, aber auch das muss man letztlich niederschreiben oder sich konkret artikulieren, um Musik zu vermitteln. Zweifellos sind wir mit dem Singen und der Chormusik Teil der gesamten Kultur, weniger als etwa in Estland, wo der Chorgesang zur DNA der Nationalität dazugehört. Wir müssen nur aufpassen, dass wir mit der sogenannten „ernsten“ Musik nicht in ein Museum geraten. Die Gefahr ist nicht so groß, weil Musik immer live produziert werden muss.
Im „Jahr der Stimme“ gilt die Aufmerksamkeit den Möglichkeiten, die eigene Stimme einzusetzen, mit dem Maul zu werken, wie Dieter Schnebel sagen würde. Wir wissen es alle: Singen muss sehr zeitig beginnen, im Kindergarten braucht es die Musikpädagogen, das Erlebnis der eigenen Stimme und des stimmlichen Miteinanders. Das macht Spaß, gibt Selbstbewusstsein und erweitert den eigenen Horizont. Nach jeder Probe fühlt man sich als Chorsänger besser als vorher. Aber: Wir müssen auch zu den Menschen gehen, können nicht erwarten, dass sie alle in Konzertsäle kommen. Es ist richtig, dass die Chöre bei Volksfesten, im Altersheim oder zur Schuleinführung singen. Uns ist ein Stück Normalität des Singens verlorengegangen, in wichtigen Lebenssituationen, bei Festen oder auch einfach bei gemeinsamen Autofahrten oder Computerspielen. Es gibt verrückte Projekte – mein Haus singt oder der Chorbus. Das sind Ideen, um das Singen mehr in den Alltag einzufügen. Und natürlich muss es viel mehr, besser und nachhaltiger gefördert werden als gegenwärtig.
Haben wir im Kampf mit oder gegen KI eine wirkliche Chance oder wird die junge Generation das Live-Erlebnis klassischer Musik künftig nur noch als kulturelles Erbe kennenlernen? Was macht uns Menschen durch klassische Musik resilienter?
KI-generierte Musik kann den Anschein von Substanz erwecken, weil in das Programmieren die besten Ideen kreativer Musiker und Musikerinnen eingeflossen sind. Aber KI kann niemals reagieren, Entscheidungen treffen, Emotionen vermitteln. Wir haben den großen Vorteil, als Musiker live zu sein, nachhaltig in den Lebensbiografien zu wirken. Die junge Generation kennt meist das klassische Musikerbe nicht mehr. Das macht aber gar nichts, weil auch diese Musik direkt wirkt, emotional anpackt, das Knie zuckt. Notwendig dafür ist der Zugang zum klassischen Erbe ohne Hemmschwellen, also gern für den Anfang auf dem Marktplatz. Sommerliche Parkmusiken sind immer beliebt. Wir müssen mehr über die Formate nachdenken, in denen wir wertvolles Erbe anbieten.
Stichwort Amateurmusikfonds: Fünf Millionen Euro für aktuell 16,3 Millionen in ihrer Freizeit musizierende Menschen – das sind reichlich 30 Cent pro Nase. Bisschen Luft nach oben müsste da eigentlich noch sein, oder?
Es war ein großartiger Erfolg, als der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) fünf Millionen für das Amateurmusikschaffen in den Bundeshaushalt einstellen lassen konnte. Diese fünf Millionen sind sicher. Sie reichen nicht, wenn wir der Überalterung von Chören entgegenwirken und Chorleiter aufbauen wollen. Der Deutsche Musikrat hat ein Projekt entwickelt, „Jugend dirigiert“, um junge Menschen ab 12 Jahren zu befähigen, Instrumentalensembles und Chöre zu leiten. Bei uns in Brandenburg hat sich das Preußische Kammerorchester Prenzlau bereiterklärt, für ganz junge Dirigenten zur Verfügung zu stehen. Es ist ein großes Erlebnis, wenn die Musiker eines Orchesters nachvollziehen, was sich der Dirigent vorstellt – Lautstärke, Tempo, Verzierungsmöglichkeiten usw. Auch hier gibt es sehr gute Beispiele, aber eben nicht flächendeckend. Es liegt also noch viel Arbeit vor uns und die kostet einfach Geld.
Gibt es in den Bundesländern große Unterschiede des Umgangs mit Kultur – es heißt, der brandenburgische Landtag habe kürzlich einen Haushalt ohne große Kürzungen im Kulturbereich verabschiedet. Hat er das seiner Präsidentin zu verdanken? Wieviel davon kommt bei den Amateurchören an?
Tatsächlich beinhaltet der gerade beschlossene Haushalt des Landes Brandenburg keine Kürzungen im Kulturbereich. Problematisch sind Tarifsteigerungen, die sich auf das Budget einer Kulturinitiative auswirken. Diesen Haushalt hat nicht die Präsidentin aufgestellt, aber sie hat natürlich permanent auf die Bedeutung von Musik und musikalischer Bildung hingewiesen. Eine ganze Reihe von kulturellen Maßnahmen war auf diese Weise möglich – Mindestlöhne für Musiker und Vokalsolisten, die Förderung von Musikfesten mit aktueller Musik, die Vernetzung zwischen Musikfesten und Universität, aber auch Kunst am Bau und Ausstellungsvergütungen für bildende Künstler, Unterstützung der Ateliermiete gehörten zu meinen Projekten.
Dennoch gibt es riesige Unterschiede zwischen den Bundesländern. Man muss sich nur die Liste der Erstplatzierungen bei „Jugend musiziert“ angucken. Nachteilig wirkt sich in Brandenburg aus, dass wir keine Musikhochschule haben, alle sehr guten jungen Leute verlassen zum Studium das Land. Es gibt wenige Profiorchester in Brandenburg, gerade habe ich das Staatsorchester Frankfurt (Oder) gehört und bin erneut begeistert von diesem hervorragenden Orchester. Im dezentralen Brandenburg, ein riesiges Flächenland, befindet sich das Staatsorchester am Rande zur polnischen Grenze und nutzt viele musikalische Kontakte nach Polen. Das Orchester ist quasi außenpolitischer Botschafter Brandenburgs. Im Amateurchor-Bereich gibt es die großen Chorfeste des Brandenburgischen Chorverbandes, zuletzt in Finsterwalde, mit großer Beteiligung und Begeisterung bei allen, die dabei waren. Immer wieder stelle ich fest, in wie vielen Bereichen Musik wirkt – Gemeinschaft in Vielfalt, Bildung, Völkerverständigung, Gesundheit usw. Bezogen auf ihre gesellschaftliche Wirkung erhalten Amateurchöre zu wenig Förderungen in Brandenburg.
Die Musik, mit der Sie sich wissenschaftlich beschäftigen und für die Sie sich sehr engagieren ist oft sehr avanciert und gehört nicht unbedingt zum Mainstream, der oft in Amateurensembles auf den Pulten liegt oder auf beliebten Open-Air-Bühnen musiziert wird. Das war zu Mendelssohns Zeit anders: Die Musikfeste im 19. Jahrhundert waren geprägt von der aktuellen Musik! Wie schaffen wir den Spagat zwischen ambitioniertem musikalischem Anspruch und dennoch großer Wirksamkeit?
Neue Musik, tatsächlich neue Kompositionsverfahren hatten es immer schwer. Jeder, der sich bewusst mit Musik viele Jahre auseinandersetzt, sucht nach dem Neuen und Besonderen. Das zu vermitteln, fällt angesichts eines sehr stark musikalisch vereinfachten Mainstreams zunehmend schwerer. Andererseits beobachte ich aber auch bei den aktuellen Kompositionen mehr Bezugssysteme als noch vor ein paar Jahren, also Intervallbezogenheit, Grundtonbezogenheit, konzeptgebundene Musik. Das ist keine Rückwärtsgewandtheit, das ist eher ein neuer Ansatz nach der erlebten Kompositionsphase der letzten 50 Jahre.
Ich mache immer gute Erfahrungen mit Publikumseinführungen. Besucherinnen und Besucher möchten geleitet werden, bei Mendelssohn genauso wie bei einem aktuellen Stück. Es gibt das Interesse zu erfahren, was hinter der Musik steckt, warum sie so und nicht anders komponiert wurde und in welchem Kontext sie entstand.
Die Medien arbeiten sprachorientiert. Wenn ich einen Film sehe und ihn nicht ertrage, weil die Filmmusik nicht gut ist, bin ich sicher eine musiktrainierte Ausnahme! Wir landen also wieder bei Hörerfahrung, bei Anleitung, musikalischer Bildung.
Kommen Sie selbst noch zum Singen in Ihrer Freizeit?
Bis vor kurzem leitete ich ein Deutsch-Arabisches Kindermusiktheater, das mit Flüchtlingskindern aus Syrien, Irak und Afghanistan gearbeitet hat. Wir haben viel gesungen miteinander. Das Lieblingslied – abends nach der Probe auf dem Nachhauseweg durch Rheinsberg von den sehr unterschiedlichen Kindern als Kanon gesungen – war „Abendstille überall“. Das hat mich sehr berührt, weil es zeigt, wie Musik verbindet und Heimaten schafft. Einem Chor gehöre ich nicht mehr an. Regelmäßige Chorproben passen einfach nicht zu meinem Tagesgeschäft. Andererseits, ganz ehrlich, Chöre brauchen junge Stimmen!
VDKC
20.08.2025