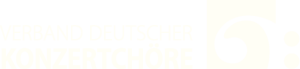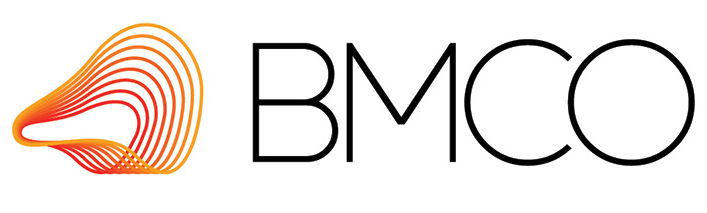Chormusik der italienischen Spätrenaissance beeinflusst ganz Europa
Er war wohl der bedeutendste Komponist katholischer Kirchenmusik.
Mit seinen zahlreichen Chorwerken setzte er während der Spätrenaissance neue Maßstäbe in der geistlichen Chormusik und prägte entscheidend deren weitere Entwicklung. Sein 500. Geburtstag, den er vermutlich in diesem Jahr feiern würde, ist Anlass, dem Leben und Werk dieses herausragenden Komponisten etwas nachzuspüren.
Giovanni Pierluigi wurde wahrscheinlich im Jahre 1525 in Palestrina, einer Kleinstadt 37 km östlich von Rom, geboren. Gesichert ist, dass er dort die erste Hälfte seiner Kindheit verbrachte und im Alter von sieben Jahren an der dortigen Singschule, der Schola cantorum, unterrichtet wurde. Bereits im Alter von zwölf Jahren übersiedelte er nach Rom, um sich dort in der Basilika Santa Maria Maggiore zum Chorknaben ausbilden zu lassen. Möglicherweise ergänzte er schon damals seinen Namen mit dem Zusatz „da Palestrina“, um auf seine Herkunft hinzuweisen. Wegen der Länge seines Namens, wurde dieser in der Folge der Einfachheit halber meistens auf „Palestrina“ abgekürzt.
Im Alter von 19 Jahren kehrte er in seine Heimatstadt Palestrina zurück, um für die nächsten sieben Jahre an der dortigen Basilika als Organist, Kapellmeister und Gesangslehrer zu wirken. Während dieser Zeit heiratete er seine erste Frau, die ihm drei Söhne gebar. Als Kirchenmusiker in Palestrina gewann er sogleich die hohe Wertschätzung des dortigen Bischof-Kardinals. Durch dessen massive Protektion wurde Palestrina bereits im Alter von nur 26 Jahren Kapellmeister im Petersdom in Rom. Wenige Jahre später wurde dieser Bischof-Kardinal zum Papst gewählt. Als Papst Julius III setzte er durch, dass sein Schützling Palestrina im Alter von 30 Jahren Mitglied der elitären Cappella Sistina, also des päpstlichen Chores, wurde, obwohl dort eigentlich keine Stelle frei war. Auf Druck seines Förderers erhielt Palestrina diese Stelle, ohne das sonst übliche strenge Aufnahmeverfahren durchlaufen zu müssen.
Da er im Gegensatz zu den meisten anderen Chormitgliedern kein Priester und zudem verheiratet war, wurde Palestrina vom nächsten Papst bereits nach wenigen Monaten aus der Cappella Sistina wieder entlassen. Obwohl er dabei mit einer großzügigen lebenslangen Rente bedacht wurde, wirkte Palestrina während der nächsten Jahre als hochgeschätzter Kapellmeister an verschiedenen bedeutenden Kirchen Roms.
Im Alter von 40 Jahren wurde Palestrina die große Ehre zuteil, vom Papst zum Komponisten der päpstlichen Kapelle ernannt zu werden. In der Folge schrieb er für diesen herausragenden Chor zahlreiche geistliche Werke, die bis in unsere Zeit dort aufgeführt werden.
Wenige Monate nach dem Tod seiner Frau heiratete Palestrina die wohlhabende Witwe eines Pelzhändlers, wodurch er fortan nebenberuflich auch in deren Pelzgeschäft mitarbeitete und sich dabei als gewiefter Geschäftsmann erwies. Diese Fähigkeit zeigte Palestrina jedoch auch bei zahlreichen Immobiliengeschäften, als Lieferant von Wein von seinen Weinbergen in seiner Heimatstadt Palestrina und auch bei der Herausgabe seiner Kompositionen. Er war ein brillanter Marketingstratege mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Dadurch brachte er es in seinem Leben zu beachtlichem Reichtum.
Im Alter von 46 Jahren wurde Palestrina noch einmal zum Kapellmeister am Petersdom bestellt. Diese Funktion übte er bis kurz vor seinem Tod aus. Da er sich dabei allseits stets höchster Wertschätzung erfreute, konnte er gegenüber dem jeweiligen Papst immer höhere Gehaltsforderungen durchsetzen. Offenbar erheblich zu hoch waren seine finanziellen Vorstellungen, als man ihn als Hofkapellmeister nach Wien und Mantua abwerben wollte. Deshalb scheiterten diese Vertragsverhandlungen.
Wenige Monate vor seinem Tod beabsichtigte Palestrina seine hochangesehenen Stellen am Petersdom in Rom aufzugeben und als Kapellmeister der Basilika seiner Heimatstadt Palestrina zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Aber bevor er dieses Vorhaben umsetzen konnte, starb er im Jahre 1594 im Alter von 69 Jahren in Rom. Wegen seiner herausragenden Verdienste wurde sein Leichnam mit großem Pomp im Petersdom beigesetzt. Auf seinem Grabstein steht die Inschrift „Musicae princeps“ („Fürst der Musik“).

Palestrina schrieb vermutlich etwa 950 Chorwerke, von denen die allermeisten geistlich sind. So komponierte er beispielsweise etwa 100 Messen und ungefähr 200 Motetten. Typisch für seinen Kompositionsstil sind folgende Merkmale:
Seine Werke sind vorwiegend polyphon und zeigen Palestrinas souveräne Meisterschaft in der Kontrapunktik in der Tradition der franko-flämischen Schule.
Zwischen den polyphonen Abschnitten erklingen in einem ausgewogenen Verhältnis auch immer wieder homophone Abschnitte.
Trotz der großen Bedeutung der Kontrapunktik war es Palestrina stets wichtig, dass die gesungenen Texte verstanden werden können.
Die Melodieführung ist sehr sanglich und weist vorwiegend Sekundschritte auf. Erfolgt in einer Stimme ein größerer Sprung, wird dieser unmittelbar darauf in derselben Stimme durch eine Gegenbewegung ausgeglichen. Chromatische, verminderte und übermäßige Melodiefortschreitungen werden vermieden.
- Die einzelnen Stimmen weisen keine Koloraturen auf und zitieren auch keine weltlichen Melodien.
- Rhythmisch fließen seine Kompositionen ruhig und gelassen dahin. Markante Rhythmen werden vermieden.
- Die Dissonanzen im Zusammenklang der Stimmen sind fein dosiert und werden immer mustergültig vorbereitet und aufgelöst.
- Der Charakter der Chorstücke ist stets würdevoll, erhaben und himmlisch abgeklärt. Die Chorwerke sind durchwegs für Aufführung in der halligen Akustik von sakralen Räumen gedacht.
- Seine geistlichen Chorwerke sind meistens für vier- bis fünfstimmigen Chor komponiert und sind durchwegs a cappella, also ohne instrumentale Begleitung, aufzuführen.
Mit seinem Stil leistete Palestrina einen wichtigen Beitrag zur „Rettung der Kirchenmusik“, als nämlich deren weiterer Einsatz in der bisherigen Form im katholischen Gottesdienst vermehrt in Frage gestellt wurde. Denn im Laufe der Renaissance wurden in den Gottesdiensten immer öfter Chorwerke aufgeführt, bei denen es den Komponisten in erster Linie darum ging, mit ihrer frappanten Meisterschaft in der kontrapunktischen Satztechnik zu imponieren. So wurden hochpolyphone Werke für mehrere Chöre und Dutzende Stimmen komponiert. Bei der Aufführung dieser kunstvollen Werke blieb die Verständlichkeit der gesungenen Texte natürlich auf der Strecke. Dadurch erfüllte diese Musik nicht mehr ihre eigentliche Funktion in der Kirche: die Verkündigung des Wort Gottes zu unterstützen.
Gegen diese Entwicklung gab es zunehmend Widerstand in der Führung der katholischen Kirche. Deshalb wurde beim Konzil von Trient (1545–1563) nicht nur über die Strategie der Gegenreformation beraten, sondern auch heftig darüber diskutiert, welche Art von Kirchenmusik künftig bei Gottesdiensten aufgeführt werden soll. Dabei stand im Raum, künftig die Aufführung kunstvoller, polyphoner Musik im Gottesdienst zu verbieten und dafür nur noch einfache Musik, bei der die Textverständlichkeit garantiert war, zuzulassen.
In dieser Situation trat Palestrina auf den Plan und komponierte vermutlich im Jahre 1562 die sechstimmige „Missa Papae Marcelli“, um mit dieser eindrucksvollen Komposition zu beweisen, dass kunstvolle, polyphone Satztechnik und Textverständlichkeit sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Pikanterweise widmete Palestrina diese Messe ausgerechnet dem wenige Jahre zuvor verstorbenen Papst Marcellus II, der während seines nur 24 Tage dauernden Pontifikats besonders heftig gegen die Aufführung von polyphoner Musik im Gottesdienst gewettert hatte.
Mit der Komposition der eindrucksvollen „Missa Papae Marcelli“ konnte Palestrina die Teilnehmer des Konzils von Trient davon abhalten, die Aufführung von anspruchsvollen, polyphonen Werken im Gottesdienst zu verbieten und dadurch die künftige Entwicklung der katholischen Kirchenmusik empfindlich zu beschneiden. Deshalb wird Palestrina oft als „Retter der Kirchenmusik“ bezeichnet. Dieses Image wurde nicht zuletzt durch die 1917 uraufgeführte Oper „Palestrina” von Hans Pfitzner kultiviert.
Seit der Aufführung der „Missa Papae Marcelli“ gilt Palestrinas Kompositionsstil durch die Ausgewogenheit zwischen Polyphonie und Homophonie, durch ihre gute Textverständlichkeit und durch ihren ruhigen, erhabenen Charakter in der katholischen Kirche als vorbildlich. Nachdem die Musik von Palestrina im Laufe der Jahrhunderte in der kirchenmusikalischen Praxis etwas an Bedeutung verloren hatte, besann man sich in der Reformbewegung „Cäcilianismus“ während des 19. Jahrhunderts wieder verstärkt des vorbildlichen Kompositionsstils von Palestrina.
Die kontrapunktische Meisterschaft Palestrinas hat auch noch heute eine große Bedeutung für die musikalische Ausbildung von angehenden Komponistinnen und Komponisten: Im Jahre 1725 verfasste der steirische Komponist und Wiener Hofkapellmeister Johann Joseph Fux das Lehrwerk „Gradus ad Parnassum“, in dem das Setzen von Kontrapunkten nach dem Vorbild Palestrinas systematisch vermittelt wird. Von diesem Lehrbuch profitierten bereits Legionen von Komponisten: vom jungen Beethoven bis in die Gegenwart.
Hubert Herburger
11.09.2025
Wir danken dem Autor und dem Chorverband Vorarlberg für die freundliche Genehmigung zum Abdruck des Textes.